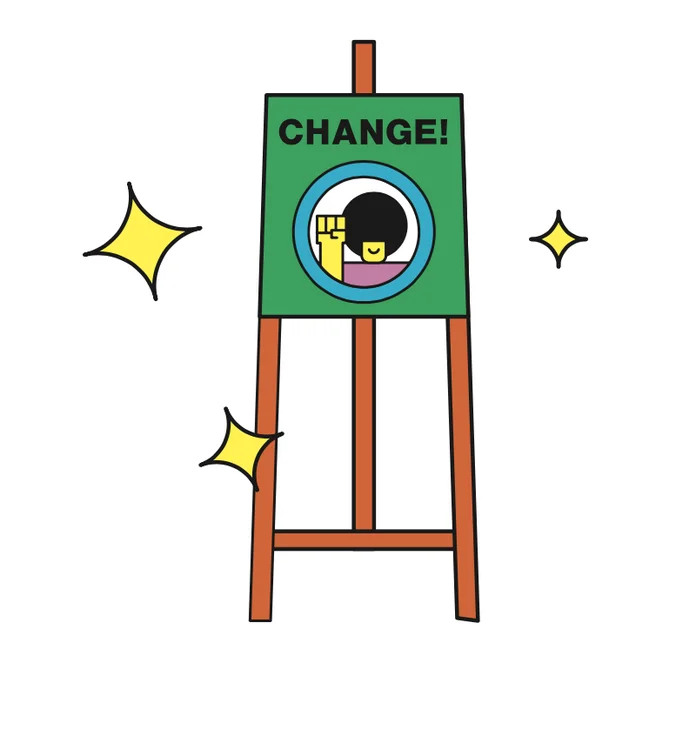Was prägt uns als Menschen? Was hat rassistische Sozialisierung mit uns als Individuen und mit uns als Gesellschaft gemacht? Wie prägt diese Sozialisierung unsere Begegnungen, unsere Familien, unsere Partnerschaften? Und was können wir tun, damit wir Rassismus im Alltag aufzeigen können? Was können Institutionen tun?
Das sind einige der vielen Fragen, die mich umtreiben.
Es war eine Verkettung von Momenten. Aber wenn ich zwei nennen sollte, dann ist das eine, dass ich irgendwann gemerkt habe: Meine Kinder machen die gleichen Rassismuserfah- rungen wie ich. Das hat mich in ein totales Gefühl der Ohnmacht und Wut getrieben. Und das andere ist die Erkenntnis, dass sprechen lernen über Rassismus im Alltag uns hilft. Es hilft uns in unseren Beziehungen. Mit meiner Mutter und meinen Großeltern, im Arbeitsleben, mit Eltern und Kindern, das ist wirklich ein Gewinn.
Die Chance, dass Sie Rassistin sind ist sehr gering. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind Sie rassistisch sozialisiert. Genauso, wie alle Menschen in Deutschland und eigentlich in dieser Welt. Denn wir alle werden in eine Welt geboren, der Rassismus bereits seit 500 Jahren in den strukturellen Knochen steckt. In allen Bereichen der Gesellschaft – angefangen bei Kinderbüchern, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, Rechtssystem, etc. Diese Sozialisierung können wir nicht verhindern und es führt dazu, dass wir Rassismus im Alltag nicht erkennen lernen und viel davon unbewusst reproduzieren. Warum erzählen Sie mir von Ihrem Schwarzen Freund Jeremy? Das finde ich interessant. Oft nutzen Menschen die Existenz eines Schwarzen Freundes als Beweismittel dafür, weniger oder gar nicht rassistisch sein zu können. Das ist aber beim näheren Hinsehen absurd. Denn das würde ja ebenso bedeuten, dass Männer, die mit Frauen befreundet oder liiert sind, die Töchter oder Schwestern haben dadurch weniger sexistisch werden. Eine enge Beziehung zu einer Schwarzen Person zu haben, kann aber dazu führen, dass man mitbekommt, was Schwarze Menschen für Erfahrungen machen. So wie Sie es in Bezug auf Ihren damaligen Freund beschreiben.
Dieses Ufer ist noch lange nicht in Sicht. Nicht für meine Generation und auch nicht für die meiner Kinder. Das ist logisch, wenn wir begreifen, wie lange es Rassismus schon gibt und wie tief er gesellschaftlich verankert ist. Wir sind in Deutschland ja immer noch an einem Punkt, wo die Existenz dieses Rassismus immer wieder zur Diskussion gestellt wird. Daher kann eine rassismusfreie Gesellschaft lediglich die große Vision am Horizont sein, aber der Weg dahin wird dauern. Und er erfordert Arbeit an einer rassismuskritischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich dem strukturellen und dem Alltagsrassismus stellt. Die ihn erkennen und benennen lernt. Und das gelingt nicht von allein, dazu braucht es Alle.
Das Schöne ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es so viele Ressourcen zu dem Thema gibt. Denn Wissen ist definitiv Macht. Die eigene Sozialisierung zu verstehen ist ein essentieller Prozess. Es geht zu allererst um eine Brücke zu sich selbst. Was hat rassistische Sozialisierung mit mir gemacht? Was habe ich gelernt zu sehen und was nicht? Was für Denkmuster habe ich verinnerlicht? Welche Vorurteile? Was für Privilegien habe ich? Dazu braucht es Mut, Selbstreflexion und Ausdauer. Toll ist es, wenn Sie diesen Prozess gemeinsam mit anderen weißen Menschen in ihrem Umfeld machen. Mit ihnen über ihre Erkenntnisse, ihre Fragen und auch ihre Emotionen in diesem Prozess sprechen. Wir haben nicht gelernt über Rassismus zu sprechen. Wir müssen das üben, wie einen Muskel, den wir trainieren wollen.
Es heißt oft, dass wir versuchen sollen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. In ihren Schuhen gehen. Ich glaube, das ist nur sehr schwer möglich. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir lernen zuzuhören und vor allem glauben, was wir hören. Auch dann, wenn wir selbst die gehörten Dinge nicht nachvollziehen können. Daher ist es im Kontext Rassismus wichtig sich die Perspektiven von Schwarzen Menschen und People of Color, die von ihren Rassismuserfahrungen berichten, anzuhören und ihnen zu glauben. Daran scheitert es oft. Rassismuserfahrungen werden wegdiskutiert, relativiert oder ignoriert.
Man darf fast alles sagen. Menschen, die behaupten, dem wäre nicht so, meinen eigentlich, dass sie keine Kritik haben wollen für das Gesagte. Das N-Wort war früher genauso rassistisch wie heute. Es gab aber weniger Widerspruch, weil die Gesellschaft insgesamt rassistischer war als heute. Heute müssen Menschen damit rechnen, dass rassistische Aussagen als solche benannt werden und es Konsequenzen hat, sich rassistisch zu verhalten. Das ist also eine sehr gute Entwicklung. Natürlich ist das unbequem für manche Menschen. Das ist Veränderung immer. Es ist aber eine Veränderung in eine rassismusärmere Welt.
Übrigens: Ich nehme Menschen nicht mit. Jeder Mensch hat eine eigene Kraft und eine eigene Verantwortung diese Gesellschaft mit zu prägen. Es freut mich, wenn Menschen meine Arbeit als hilfreich für ihren eigenen Prozess empfinden. Aber die Entscheidung, ob Menschen in Bezug auf Rassismus Teil des Problems oder Teil der Lösung sein wollen, die muss jede Person selbst treffen.
Sprache schafft Wirklichkeit. Sprache ist Macht. Sprache ist genauso wirkmächtig wie Handlungen. Sie hat Konsequenzen, kann Realitäten schaffen, kann verletzen, zerstören und töten. Ebenso kann sie stärken, inspirieren und Gerechtigkeit schaffen.
Gleichzeitig ist Sprache ein Mittel, bei dem wir ansetzen können, um rassismusärmere Räume zu schaffen. Ich wünsche mir mehr Freude über diese Chance.
Ja, sehr. Ich hatte das Privileg durch meine Familie oft und viel ins Theater gehen zu dürfen. Ich habe dadurch sogar selbst eine Zeitlang davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Bis eine rassistische Inszenierung, in der ich mitspielen sollte, diesen Traum beendet hat. Dazu wurde mir auch davon abgeraten, da es keine Rollen geben würde für Menschen wie mich.
In meiner Funktion als Vermittlerin für Rassismuskritik habe ich inzwischen an vielen Staatstheatern und kleineren Häusern in Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Inspirierend finde ich Theaterhäuser wie zum Beispiel das Schlachthaus Theater in Bern oder das Ballhaus Naunynstraße Berlin. Dort habe ich Menschen getroffen, die sich aktiv auf einen rassismuskritischen Weg begeben, die die Chance nutzen, innerhalb der eigenen Strukturen, aber auch in den Produktionen gesellschaftskritische Themen aufzugreifen und mutig zu bearbeiten.
Es ist toll, innerhalb kürzester Zeit und sehr barrierearm eine sehr große Anzahl an Menschen zu erreichen. Social Media schafft es, Themen, die nicht in klassischen Mainstreamkanälen wie Fernsehen verhandelt werden, zu thematisieren. Und Social Media hat dazu geführt, dass Rassismus und andere Diskriminierungsformen sichtbarer für eine große Mehrheit werden. Zum Beispiel der Mord an George Floyd. Natürlich hat Social Media auch große Schattenseiten. Daher ist es für mich oft ein zweischneidiges Schwert.
Ich spreche nicht mit Rassist:innen. Meine Menschlichkeit liegt nicht offen auf dem Verhandlungstisch.
Wer ist auf der einen Seite und wer auf der anderen? Und was überbrücken wir denn überhaupt? Im schlimmsten Fall legitimiert diese Idee der Brücke die rassistische Fehlannahme, dass es ein »wir« und »die Anderen« ein »normal« und ein »anders« gibt. Wir sind alle Menschen in einem Land, in einer Welt. Wir alle sind politische Wesen, per Existenz. Wir alle haben die Aufgabe, diese Welt mitzugestalten. Und eine Aufgabe vor allem für weiße Menschen ist es, den verinnerlichten Rassismus zu dekonstruieren.
Kultureinrichtungen haben eine große gesellschaftliche Verantwortung und gleichzeitig eine große Chance. Sie prägen Gesellschaft mit. Sie können Utopien und Dystopien zeichnen. Sie können Gesellschaftsanalyse betreiben und Gesellschaft imaginieren. Auch der Kulturbereich ist durchzogen von Rassismen und Sexismen. Weiße männliche Perspektiven dominieren seit langem. Ich freue mich, dass es immer mehr Bewegung im Kulturbereich gibt, wo vielfältige Perspektiven und Geschichten Platz und Raum einnehmen. Aber auch diese Bewegung trifft auf Widerstand. Ich wünsche mir, dass die so oft beschworene Kunstfreiheit dafür genutzt wird alteingesessene Machtstrukturen zu hinterfragen und rassimuskritische und empowernde Inhalte zu produzieren.
Das Gespräch führte Marlene Hahn (Chefdramaturgin)